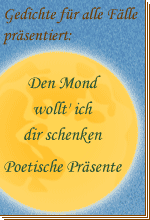Eduard Mörike
Eduard Mörike
Zurückgezogenheit ist wohl der treffendste Begriff, um den schwäbischer Pfarrer und Dichter Eduard Mörike (1804-1875) zu beschreiben. Er wurde bereits 1843 aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand versetzt, übers Schwabenland ist er kaum hinausgekommen und das politische Aufbegehren vor der 48er-Revolution, in das beispielsweise sein Bruder Karl Eberhard direkt verstrickt war, findet sich nicht in seinen Werken wieder.
Nein, Aufbegehren war seine Sache nicht. Nach dem Tod seines Vaters 1817 fügte er sich in die geistliche Ausbildung und Berufslaufbahn, nicht so sehr aus der Begeisterung für den Glauben, sondern weil dies eine kostengünstige Möglichkeit war, eine solide, bürgerlichen Ansprüchen genügende Stellung zu erhalten.
Nur kurz wagte er aus dieser vorgezeichneten Bahn auszubrechen, als er 1828 im Franckh-Verlag als Redakteur arbeitete. Doch das Schreiben auf Termin hin war ihm eine derartige Tortur, dass er die Stellung nach drei Monaten wieder aufgab.
„Ein schönes Werk von innen heraus zu bilden, dazu bedarf’s vor allem der Ruhe und einer Existenz, die uns erlaubt, die Stimmung abzuwarten.“
(Eduard Mörike, zitiert nach: Eduard Mörike Werke in drei Bänden, Band 1, hrsg. von August Leffson, bearbeitet von Gisela Spiekerkötter. Zürich: Stauffacher-Verlag 1965, S. 19)
Die Natur und die Liebe boten die Anlässe, die Eduard Mörike
lyrisch so befügelten, dass seine Gedichte noch heutzutage bekannt sind.
Zu nennen wäre Er ist’s in ![]() Frühlingsgedichte oder z.B. dieses hier:
Frühlingsgedichte oder z.B. dieses hier:
Im Nebel ruhet noch die Welt,
Noch träumen Wald und Wiesen:
Bald siehst du, wenn der Schleier fällt,
Den blauen Himmel unverstellt,
Herbstkräftig die gedämpfte Welt
Im warmen Golde fließen.
Auch wenn sich in erster Linie die Kurzgedichte Mörikes als Dauerbrenner erhalten haben, war er doch ein Dichter, der zumindest lyrisch gern „länger reiste“:
An einem Wintermorgen, vor Sonnenaufgang
O flaumenleichte Zeit der dunkeln Frühe!
Welch neue Welt bewegest du in mir?
Was ist’s, daß ich auf einmal nun in dir
Von sanfter Wollust meines Daseins glühe?
Einem Kristall gleicht meine Seele nun,
Den noch kein falscher Strahl des Lichts getroffen;
Zu fluten scheint mein Geist, er scheint zu ruhn,
Dem Eindruck naher Wunderkräfte offen,
Die aus dem klaren Gürtel blauer Luft
Zuletzt ein Zauberwort vor meine Sinne ruft.
Bei hellen Augen glaub’ ich doch zu schwanken;
Ich schließe sie, daß nicht der Traum entweiche.
Seh’ ich hinab in lichte Feenreiche?
Wer hat den bunten Schwarm von Bildern und Gedanken
Zur Pforte meines Herzens hergeladen,
Die glänzend sich in diesem Busen baden,
Goldfarb’gen Fischlein gleich im Gartenteiche?
Ich höre bald der Hirtenflöten Klänge,
Wie um die Krippe jener Wundernacht,
Bald weinbekränzter Jugend Lustgesänge;
Wer hat das friedenselige Gedränge
In meine traurigen Wände hergebracht?
Und welch Gefühl entzückter Stärke,
Indem mein Sinn sich frisch zur Ferne lenkt!
Vom ersten Mark des heutgen Tags getränkt,
Fühl ich mir Mut zu jedem frommen Werke.
Die Seele fliegt, so weit der Himmel reicht,
Der Genius jauchzt in mir! Doch sage,
Warum wird jetzt der Blick von Wehmut feucht?
Ist’s ein verloren Glück, was mich erweicht?
Ist es ein werdendes, was ich im Herzen trage?
- Hinweg, mein Geist! hier gilt kein Stillestehn:
Es ist ein Augenblick, und alles wird verwehn!
Dort, sieh! am Horizont lüpft sich der Vorhang schon!
Es träumt der Tag, nun sei die Nacht entflohn;
Die Purpurlippe, die geschlossen lag,
Haucht, halbgeöffnet, süße Atemzüge:
Auf einmal blitzt das Aug’, und, wie ein Gott, der Tag
Beginnt im Sprung die königlichen Flüge!
Es graut im Morgenreif
In Dämmerung das Feld,
Da schon ein blasser Streif
Den fernen Ost erhellt.
Man sieht im Lichte bald
Den Morgenstern vergehn,
Und doch am Fichtenwald
Den vollen Mond noch stehn:
So ist mein scheuer Blick,
Den schon die Ferne drängt,
Noch in das Schmerzensglück
Der Abschiedsnacht versenkt.
Dein blaues Auge steht,
Ein dunkler See, vor mir,
Dein Kuß, dein Hauch umweht,
Dein Flüstern mich noch hier.
An deinem Hals begräbt
Sich weinend mein Gesieht,
Und Purpurschwärze webt
Mir vor dem Auge dicht.
Die Sonne kommt. Sie scheucht
Den Traum hinweg im Nu,
Und von den Bergen streicht
Ein Schauer auf mich zu.
In dieser Winterfrühe
Wie ist mir doch zumut!
O Morgenrot, ich glühe
Von deinem Jugendblut.
Es glüht der alte Felsen,
Und Wald und Burg zumal,
Berauschte Nebel wälzen
Sich jäh hinab das Tal.
Mit tatenfroher Eile
Erhebt sich Geist und Sinn,
Und flügelt goldne Pfeile
Durch alle Ferne hin.
Auf Zinnen möcht ich springen,
In alter Fürsten Schloß,
Möcht hohe Lieder singen,
Mich schwingen auf das Roß!
Und stolzen Siegeswagen
Stürzt’ ich mich brausend nach!
Die Harfe wird zerschlagen,
Die nur von Liebe sprach. –
Wie? schwärmst du so vermessen,
Herz, hast du nicht bedacht,
Hast du mit eins vergessen,
Was dich so trunken macht?
Ach, wohl! was aus mir singet,
Ist nur der Liebe Glück!
Die wirren Töne schlinget
Sie sanft in sich zurück.
Was hilft, was hilft mein Sehnen?
Geliebte, wärst du hier!
In tausend Freudetränen
Verging' die Erde mir.
Sehnsucht aus dem Jahr 1830 war eine Frucht seiner Liebe zu Luise
Rau, die nach vierjähriger Verlobungszeit und vielen, durch seine Vikariatszeit
bedingten örtlichen Trennungen, unglücklich endete, woraus eins
seiner bekanntesten Gedichte, Lebewohl (in ![]() Trennungsgedichte), resultierte.
Trennungsgedichte), resultierte.
Weniger bekannt sind seine mythisch-idealistischen Gedichte und Balladen, obwohl sie den Dichtungen seiner Zeitgenossen in Nichts nachstehen.
Am schwarzen Berg da steht der Riese,
Steht hoch der Mond darüber her;
Die weißen Nebel auf der Wiese
Sind Wassergeister aus dem Meer:
Ihrem Gebieter nachgezogen
Vergiften sie die reine Nacht,
Aus deren hoch geschwungnem Bogen
Das volle Heer der Sterne lacht.
Still schaut der Herr auf seine Geister,
Die Faust am Herzen fest geballt;
Er heißt der Elemente Meister,
Heißt Herr der tödlichen Gewalt.
Ein Gott hat sie ihm übergeben,
Ach, ihm die schmerzenreichste Lust!
Und namenlose Seufzer heben
Die ehrne, göttergleiche Brust.
Die Keule schwingt er jetzt, die alte,
Vom Schlage dröhnt der Erde Rund,
Dann springt durch die gewalt’ge Spalte
Der Riesenkörper in den Grund.
Die fest verschloßnen Feuer tauchen
Hoch aus uraltem Schlund herauf,
Da fangen Wälder an zu rauchen,
Und prasseln wild im Sturme auf.
Er aber darf nicht still sich fühlen,
Beschaulich im verborgnen Schacht,
Wo Gold und Edelsteine kühlen,
Und hellen Augs der Elfe wacht:
Brünstig verfolgt er, rastlos wütend,
Der Gottheit grauenvolle Spur,
Des Busens Angst nicht überbietend
Mit allen Schrecken der Natur.
Soll er den Flug von hundert Wettern
Laut donnernd durcheinander ziehn,
Des Menschen Hütte niederschmettern,
Aufs Meerschiff sein Verderben sprühn:
Da will das edle Herz zerreißen,
Da sieht er schrecklich sich allein;
Und doch kann er nicht würdig heißen,
Mit Göttern ganz ein Gott zu sein.
Noch aber blieb ihm eine Freude,
Nachdem er Land und Meer bewegt,
Wenn er bei Nacht auf öder Heide
Die Sehnsucht seiner Seele pflegt.
Da hängen ungeheure Ketten
Aus finsterm Wolkenraum herab,
Dran er, als müßten sie ihn retten,
Sich schwingt zum Himmel auf und ab.
Dort weilen rosige Gestalten
In heitern Höhen, himmlisch klar,
Und fest am goldnen Ringe halten
Sie schwesterlich das Kettenpaar;
Sie liegen ängstlich auf den Knieen
Und sehen sanft zum wilden Spiel,
Und wie sie im Gebete glühen,
Löst, wie ein Traum, sich sein Gefühl.
Denn ihr Gesang tönt mild und leise,
Er rührt beruhigend sein Ohr:
O folge harmlos deiner Weise,
Dazu Allvater dich erkor!
Dem Wort von Anfang mußt du trauen,
In ihm laß deinen Willen ruhn!
Das Tiefste wirst du endlich schauen,
Begreifen lernen all dein Tun.
Und wirst nicht länger menschlich hadern,
Wirst schaun der Dinge heil’ge Zahl:
Wie in der Erde warmen Adern,
Wie in dem Frühlingssonnenstrahl,
Wie in des Sturmes dunkeln Falten
Des Vaters göttlich Wesen schwebt,
Den Faden freundlicher Gewalten,
Das Band geheimer Eintracht webt.
Einst wird es kommen, daß auf Erden
Sich höhere Geschlechter freun,
Und heitre Angesichter werden
Des Ewigschönen Spiegel sein,
Wo aller Engelsweisheit Fülle
Der Menschengeist in sich gewahrt,
In neuer Sprachen Kinderhülle
Sich alles Wesen offenbart.
Und auch die Elemente mögen,
Die gottversöhnten, jede Kraft
In Frieden auf und nieder regen
Die nimmermehr Entsetzen schafft;
Dann, wie aus Nacht und Duft gewoben,
Vergeht dein Leben unter dir,
Mit lichtem Blick steigst du nach oben,
Denn in der Klarheit wandeln wir.
Es war ein König Milesint,
Von dem will ich euch sagen:
Der meuchelte sein Bruderskind,
Wollte selbst die Krone tragen.
Die Krönung ward mit Prangen
Auf Liffey-Schloß begangen.
O Irland! Irland! warest du so blind?
Der König sitzt um Mitternacht
Im leeren Marmorsaale,
Sieht irr in all die neue Pracht,
Wie trunken von dem Mahle;
Er spricht zu seinem Sohne:
„Noch einmal bring’ die Krone!
Doch schau, wer hat die Pforten aufgemacht?“
Da kommt ein seltsam Totenspiel,
Ein Zug mit leisen Tritten,
Vermummte Gäste groß und viel,
Eine Krone schwankt inmitten;
Es drängt sich durch die Pforte
Mit Flüstern ohne Worte;
Dem Könige, dem wird so geisterschwül.
Und aus der schwarzen Menge blickt
Ein Kind mit frischer Wunde;
Es lächelt sterbensweh und nickt,
Es macht im Saal die Runde,
Es trippelt zu dem Throne,
Es reichet eine Krone
Dem Könige, des Herze tief erschrickt.
Darauf der Zug von dannen strich,
Von Morgenluft berauschet,
Die Kerzen flackern wunderlich,
Der Mond am Fenster lauschet;
Der Sohn mit Angst und Schweigen
Zum Vater tät sich neigen -
Er neiget über eine Leiche sich.
Ganz und gar unbekannt oder besser gesagt vergessen ist die humorige Seite Eduard Mörikes, die in den beiden folgenden Epigrammen zum Ausdruck kommt:
Geistreich seid ihr, glänzend, wahrlich, daß
ich euch bewundern müßte,
Wenn sich nur bei euch nicht jede Zeile selber geistreich wüßte!
Vor lauter hochadligen Zeugen
Kopuliert man ihrer zwei;
Die Orgel hängt voll Geigen,
Der Himmel nicht, mein’ Treu!
Seht doch, sie weint ja greulich,
Er macht ein Gesicht abscheulich!
Denn leider freilich, freilich
Keine Lieb’ ist nicht dabei.
Und völlig dem Bild vom gemütlichen schwäbischen Pfarrer widersprechend ist das folgende Gedicht, das 1862 zu einem in der Zeitschrift Freya veröffentlichten Holzschnitt entstand:
Wasch dich, mein Schwesterchen, wasch dich!
Zu Robins Hochzeit gehn wir heut:
Er hat die stolze Ruth gefreit.
Wir kommen ungebeten;
Wir schmausen nicht, wir tanzen nicht
Und nicht mit lachendem Gesicht
Komm ich vor ihn zu treten.
Strähl’ dich, mein Schwesterchen, strähl’
dich!
Wir wollen ihm singen ein Rätsellied,
Wir wollen ihm klingen ein böses Lied;
Die Ohren sollen ihm gellen.
Ich will ihr schenken einen Kranz
Von Nesseln und von Dornen ganz.
Damit fährt sie zur Höllen!
Schick’ dich, mein Schwesterchen, schmück’
dich!
Derweil sie alle sind am Schmaus,
Soll rot in Flammen stehn das Haus,
Die Gäste schreien und rennen.
Zwei sollen sitzen unverwandt,
Zwei hat ein Sprüchlein festgebannt;
Zu Kohle müssen sie brennen!
Lustig, mein Schwesterchen, lustig!
Das war ein alter Ammensang.
Den falschen Rob vergaß ich lang.
Er soll mich sehen lachen!
Hab ich doch einen andern Schatz,
Der mit mir tanzet auf dem Platz -
Sie werden Augen machen!
Tatsächlich ist außer einem gewissen Mystizismus wenig zu spüren von dem Pfarrer Mörike. Gepredigt hat er in seinen Gedichten nie - fast nie; diese eine kaum bekannte Ausnahme bestätigt nur die Regel:
Ist’s möglich? Sieht ein Mann so heiter aus,
Dem, was der Väter Fleiß erst gründete,
Was vieler Jahre stille Tätigkeit,
Kraft und Geduld und Scharfsinn ihm gewann,
In einer Stunde fraß der Flamme Gier? –
Ihn hebt die Flut des herrlichen Gefühles,
Davon die brüderliche Menschheit rings
Im schönen Aufruhr schwärmt und Ehre mehr
Als Mitleid zollt verhängnisheil’gem Unglück.
Es dringt dieselbe Macht, die so ihn schlug,
Die ew’ge, grenzenloser Liebe voll,
Aus so viel tausend Herzen auf ihn ein,
Und wie zum erstenmal in ihre Tiefe
Hinunter staunend, wirft er lachend weg
Den Rest der Schmerzen. Ihm hat sich ein Schatz
Im unerforschten Busen aufgetan,
Und nichts besitzend, ward er überreich;
Denn nun erst einen Menschen fühlt er sich! –
Indem er heute noch, sein neues Glück
Zu baun, den ersten Stein entschlossen legt
Und schon im Geiste den späten Gipfel grüßt,
Magst du, o feige Welt, erkennen, was
Der Mensch vermag, wenn ihn ein Gott beseelt.
Nachdem nun so viel an eher unbekannten Seiten Mörikes gezeigt wurde, zum Schluss noch ein Gedicht, das den Beginn vom zurückgezogen lebenden Dichter wieder aufnimmt und einen typischen Mörike bietet:
Laß, o Welt, o laß mich sein!
Locket nicht mit Liebesgaben,
Laßt dies Herz alleine haben
Seine Wonne, seine Pein!
Was ich traure, weiß ich nicht,
Es ist unbekanntes Wehe;
Immerdar durch Tränen sehe
Ich der Sonne liebes Licht.
Oft bin ich mir kaum bewußt,
Und die helle Freude zücket
Durch die Schwere, so mich drücket
Wonniglich in meiner Brust.
Laß, o Welt, o laß mich sein!
Locket nicht mit Liebesgaben,
Laßt dies Herz alleine haben
Seine Wonne, seine Pein!
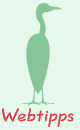 Mörike im Internet
Mörike im Internet
Die beste Quelle für die Auseinandersetzung mit dem Leben und Werk Mörikes bietet die Website Mediaculture Online, die anlässlich seines 200. Geburtstages viele Texte zur Verfügung stellte, einschließlich Hörproben vertonter Mörike-Texte. Als Einstieg empfiehlt sich wie so oft Xlibris.
Verwandte Themen: Balladen · Epigramme
Alle Themen: Startseite