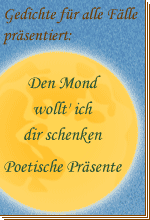Heinrich Heine
Heinrich Heine
Den höchsten Begriff vom Lyriker hat mir Heinrich Heine gegeben. Ich suche umsonst in allen Reichen der Jahrtausende nach einer gleich süßen und leidenschaftlichen Musik. Er besaß jene göttliche Bosheit, ohne die ich mir das Vollkommne nicht zu denken vermag.
(Friedrich Nietzsche, "Ecce Homo" 1888)
Dieses Urteil aus dem berufenenen Mund eines begnadeten Stilisten lässt uns hier die Ohren für den zwar berühmten, aber bis heute manch einem auch berüchtigten Heinrich Heine einmal neu spitzen.
Weltweit wie ein Inbegriff deutscher Dichtung hochgeschätzt ist sein Lorelei-Gedicht, das in der Vertonung von Friedrich Silcher jeder nachsummen kann. Sehr prominent sind auch "Die Grenadiere", die Robert Schumann und Richard Wagner in Musik gesetzt haben.
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
Dass ich so traurig bin;
Ein Märchen aus alten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.
Die Luft ist kühl und es dunkelt,
Und ruhig fließt der Rhein;
Der Gipfel des Berges funkelt
Im Abendsonnenschein.
Die schönste Jungfrau sitzet
Dort oben wunderbar;
Ihr goldnes Geschmeide blitzet,
Sie kämmt ihr goldenes Haar.
Sie kämmt es mit goldenem Kamme
Und singt ein Lied dabei;
Das hat eine wundersame,
Gewaltige Melodei.
Den Schiffer im kleinen Schiffe
Ergreift es mit wildem Weh;
Er schaut nicht die Felsenriffe,
Er schaut nur hinauf in die Höh.
Ich glaube, die Wellen verschlingen
Am Ende Schiffer und Kahn;
Und das hat mit ihrem Singen
Die Lorelei getan.
(Erstdruck 1824; zur Vorlage, Brentanos Gedicht "Zu Bacherach am Rheine",
in ![]() Balladen)
Balladen)
Nach Frankreich zogen zwei Grenadier',
Die waren in Rußland gefangen.
Und als sie kamen ins deutsche Quartier,
Sie ließen die Köpfe hangen.
Da hörten sie beide die traurige Mär:
Dass Frankreich verlorengegangen,
Besiegt und zerschlagen das große Heer
Und der Kaiser, der Kaiser gefangen.
Da weinten zusammen die Grenadier'
Wohl ob der kläglichen Kunde.
Der eine sprach: »Wie weh wird mir,
Wie brennt meine alte Wunde!«
Der andre sprach: »Das Lied ist aus,
Auch ich möcht mit dir sterben,
Doch hab ich Weib und Kind zu Haus,
Die ohne mich verderben.«
»Was schert mich Weib, was schert mich Kind,
Ich trage weit bessres Verlangen;
Laß sie betteln gehn, wenn sie hungrig sind -
Mein Kaiser, mein Kaiser gefangen!
Gewähr mir, Bruder, eine Bitt':
Wenn ich jetzt sterben werde,
So nimm meine Leiche nach Frankreich mit,
Begrab mich in Frankreichs Erde.
Das Ehrenkreuz am roten Band
Sollst du aufs Herz mir legen;
Die Flinte gib mir in die Hand,
Und gürt mir um den Degen.
So will ich liegen und horchen still,
Wie eine Schildwach', im Grabe,
Bis einst ich höre Kanonengebrüll
Und wiehernder Rosse Getrabe.
Dann reitet mein Kaiser wohl über mein Grab,
Viel Schwerter klirren und blitzen;
Dann steig ich gewaffnet hervor aus dem Grab -
Den Kaiser, den Kaiser zu schützen!«
(laut Heine 1816, wohl aber erst 1819 entstanden)
Da Heines Dichten stets in persönlichem Erleben oder Denken gründet, lässt sich hier bereits Wesentliches über sein Schreiben und Leben heraushören. Da ist ersterdings Begeisterung, Einsatz, Hingabe für etwas Geliebtes, ob dies ein Wert, Ideal oder Mensch ist, dann aber unweigerlich die Desillusionierung und Zerstörung, zu der solche Passion führt. So spricht aus den Grenadieren neben anderem auch noch Heines jugendliche, von der Restauration enttäuschte Hoffnung, Napoleon Bonaparte könnte zum Einiger eines Europa der verwirklichten Ideale der Französischen Revolution werden.
Wie Heines wichtigste Antriebe, der Eros und der Kampf für Freiheit und Demokratie, im wahrsten Wortsinn zusammenhängen, hat er so in Verse eingebunden:
In Gemäldegalerien
Siehst du oft das Bild des Manns,
Der zum Kampfe wollte ziehen,
Wohlbewehrt mit Schild und Lanz'.
Doch ihn necken Amoretten,
Rauben Lanze ihm und Schwert,
Binden ihn mit Blumenketten,
Wie er auch sich mürrisch wehrt.
So, in holden Hindernissen,
Wind ich mich in Lust und Leid,
Während andre kämpfen müssen
In dem großen Kampf der Zeit.
(Prolog zum Kapitel "Neuer Frühling" in "Neue Gedichte",
die 1844 erschienen)
Heine war natürlich vor allem ein Streiter mit Wort und Witz, der dafür auch neuartige publizistische Wege beschritt - man nennt ihn Begründer des Feuilletons und den ersten deutschen Journalisten. Bekämpft wurde er mit Zensur, Publikationsverboten und Haftbefehlen.
Doch bisweilen ist sein Kriegertum allzu wörtlich geraten: Wegen eines Duells wurde er 1821 für ein halbes Jahr der Univerität verwiesen. Heines stolzes Rebellentum bedient sich des ältest-möglichen Ahnherren und schreckt auch nicht vor höchster Autorität zurück:
Du schicktest mit dem Flammenschwert
Den himmlischen Gendarmen,
Und jagtest mich aus dem Paradies,
Ganz ohne Recht und Erbarmen!
Ich ziehe fort mit meiner Frau
Nach andren Erdenländern;
Doch daß ich genossen des Wissens Frucht,
Das kannst du nicht mehr ändern.
Du kannst nicht ändern, daß ich weiß,
Wie sehr du klein und nichtig,
Und machst du dich auch noch so sehr
Durch Tod und Donnern wichtig.
O Gott! wie erbärmlich ist doch dies
Consilium abeundi!
Das nenne ich einen Magnifikus
Der Welt, ein lumen mundi!
Vermissen werde ich nimmermehr
Die paradiesischen Räume;
Das war kein wahres Paradies -
Es gab dort verbotene Bäume.
Ich will mein volles Freiheitsrecht!
Find ich die g'ringste Beschränknis,
Verwandelt sich mir das Paradies
In Hölle und Gefängnis.
(1844 in "Neue Gedichte"; der lateinische 2. Vers der 4. Strophe lautet übersetzt: Rat, abzugehen. Dieser Terminus meinte einen befristeten Verweis von der Universität, wie er auch Heine widerfahren war. - Im übernächsten Vers "lumen mundi" = Licht der Welt.)
Nun endlich zur weitaus größeren Macht, die den selbstbewussten Dichter sirenisch wie die Lorelei hinanzog: Frauen, die nicht lediglich sagenhaft sind. Zum Genießen sollen hier sieben lyrische Herzchen stehen, die auch aus anderen dieser Lyrik-Lesezeichen erklingen und als Beispiele dienen, wie Heine die Liebe in allen ihren Stationen und Variationen unerschöpflich besingt. Beginnen wir stilgerecht Im wunderschönen Monat Mai... (![]() Liebesgedichte), wo frisch und verspielt die Augen einmal zugehalten, dann zum Gesundbrunnen und quasi Einstieg werden für Diese schönen Gliedermassen... (
Liebesgedichte), wo frisch und verspielt die Augen einmal zugehalten, dann zum Gesundbrunnen und quasi Einstieg werden für Diese schönen Gliedermassen... (![]() Erotische Gedichte). Unten auf der hiesigen Seite folgt dann aber schon eine verblümte Aufforderung, wie Alltag und -nacht einer längeren Beziehung laufen sollte, und da ist es wohl schon nicht mehr weit zur 'Liebesasche': Verlust und dessen Bewältigung wie auch in Wir haben viel füreinander gefühlt... (
Erotische Gedichte). Unten auf der hiesigen Seite folgt dann aber schon eine verblümte Aufforderung, wie Alltag und -nacht einer längeren Beziehung laufen sollte, und da ist es wohl schon nicht mehr weit zur 'Liebesasche': Verlust und dessen Bewältigung wie auch in Wir haben viel füreinander gefühlt... (![]() Trennungsgedichte).
Trennungsgedichte).
Ich halte ihr die Augen zu
Und küss sie auf den Mund;
Nun lässt sie mich nicht mehr in Ruh',
Sie fragt mich um den Grund.
Von Abend spät bis morgens fruh,
Sie fragt zu jeder Stund':
»Was hältst du mir die Augen zu,
Wenn du mir küsst den Mund?«
Ich sag ihr nicht, weshalb ich's tu,
Weiß selber nicht den Grund -
Ich halte ihr die Augen zu
Und küss sie auf den Mund.
(aus "Neue Gedichte", 1844)
Wenn ich in deine Augen seh,
So schwindet all mein Leid und Weh;
Doch wenn ich küsse deinen Mund,
So werd ich ganz und gar gesund.
Wenn ich mich lehn an deine Brust,
Kommt's über mich wie Himmelslust;
Doch wenn du sprichst: »Ich liebe dich!«,
So muss ich weinen bitterlich.
(aus "Buch der Lieder", 1827)
Morgens send ich dir die Veilchen,
Die ich früh im Wald gefunden,
Und des Abends bring ich Rosen,
Die ich brach in Dämmrungstunden.
Weißt du, was die hübschen Blumen
Dir Verblümtes sagen möchten?
Treu sein sollst du mir am Tage
Und mich lieben in den Nächten.
(aus "Neue Gedichte", 1844)
"Sag, wo ist dein schönes Liebchen,
Das du einst so schön besungen,
Als die zaubermächt'gen Flammen
Wunderbar dein Herz durchdrungen?"
Jene Flammen sind erloschen,
Und mein Herz ist kalt und trübe,
Und dies Büchlein ist die Urne
Mit der Asche meiner Liebe.
(aus "Buch der Lieder", 1827)
Als zusätzliche Liebesvariante sei auf die beiden Sonette An meine Mutter (in ![]() Muttertagsgedichte) verwiesen. Dies ist als Gegenpart zur Hassliebe auf Deutschland noch im folgenden Gedicht ausgesprochen, gleichfalls die große Enttäuschung und Abwendung von einem feindseligen, geknechteten Vaterland zugunsten von menschlicher Wärme.
Muttertagsgedichte) verwiesen. Dies ist als Gegenpart zur Hassliebe auf Deutschland noch im folgenden Gedicht ausgesprochen, gleichfalls die große Enttäuschung und Abwendung von einem feindseligen, geknechteten Vaterland zugunsten von menschlicher Wärme.
Denk ich an Deutschland in der Nacht,
Dann bin ich um den Schlaf gebracht,
Ich kann nicht mehr die Augen schließen.
Und meine heißen Tränen fließen.
Die Jahre kommen und vergehn!
Seit ich die Mutter nicht gesehn,
Zwölf Jahre sind schon hingegangen;
Es wächst mein Sehnen und Verlangen.
Mein Sehnen und Verlangen wächst.
Die alte Frau hat mich behext,
Ich denke immer an die alte,
Die alte Frau, die Gott erhalte!
Die alte Frau hat mich so lieb,
Und in den Briefen, die sie schrieb,
Seh ich, wie ihre Hand gezittert,
Wie tief das Mutterherz erschüttert.
Die Mutter liegt mir stets im Sinn.
Zwölf lange Jahre flossen hin,
Zwölf lange Jahre sind verflossen,
Seit ich sie nicht ans Herz geschlossen.
Deutschland hat ewigen Bestand,
Es ist ein kerngesundes Land;
Mit seinen Eichen, seinen Linden,
Werd ich es immer wiederfinden.
Nach Deutschland lechzt' ich nicht so sehr,
Wenn nicht die Mutter dorten wär;
Das Vaterland wird nie verderben,
Jedoch die alte Frau kann sterben.
Seit ich das Land verlassen hab,
So viele sanken dort ins Grab,
Die ich geliebt - wenn ich sie zähle,
So will verbluten meine Seele.
Und zählen muß ich - Mit der Zahl
Schwillt immer höher meine Qual,
Mir ist, als wälzten sich die Leichen
Auf meine Brust - Gottlob! sie weichen!
Gottlob! durch meine Fenster bricht
Französisch heitres Tageslicht;
Es kommt mein Weib, schön wie der Morgen,
Und lächelt fort die deutschen Sorgen.
(1844 in "Neue Gedichte")
Die folgende, in ihrer wechselnden Perspektivik und Beschreibungskraft bestechende Ballade zeigt Heines sozialkritisch motivierten und auf Aktualität setzenden Umgang mit dieser Gedichtform (ähnlich Die schlesischen Weber in ![]() Balladen). Doch über den (höchst aktuell gebliebenen) Angriff auf globale Geschäftermacherei und allzu freien Welthandel hinaus dürfte ihm das Sklavenschiff auch ein Bild für die deutschen Verhältnisse gewesen sein, ja sogar für seine persönliche Lage, da er in seinen letzten acht Jahren ans Bett gefesselt nur noch das Ende erwarten konnte.
Balladen). Doch über den (höchst aktuell gebliebenen) Angriff auf globale Geschäftermacherei und allzu freien Welthandel hinaus dürfte ihm das Sklavenschiff auch ein Bild für die deutschen Verhältnisse gewesen sein, ja sogar für seine persönliche Lage, da er in seinen letzten acht Jahren ans Bett gefesselt nur noch das Ende erwarten konnte.
I
Der Superkargo Mynheer van Koek
Sitzt rechnend in seiner Kajüte;
Er kalkuliert der Ladung Betrag
Und die probabeln Profite.
»Der Gummi ist gut, der Pfeffer ist gut,
Dreihundert Säcke und Fässer;
Ich habe Goldstaub und Elfenbein -
Die schwarze Ware ist besser.
Sechshundert Neger tauschte ich ein
Spottwohlfeil am Senegalflusse.
Das Fleisch ist hart, die Sehnen sind stramm,
Wie Eisen vom besten Gusse.
Ich hab zum Tausche Branntewein,
Glasperlen und Stahlzeug gegeben;
Gewinne daran achthundert Prozent,
Bleibt mir die Hälfte am Leben.
Bleiben mir Neger dreihundert nur
Im Hafen von Rio-Janeiro,
Zahlt dort mir hundert Dukaten per Stück
Das Haus Gonzales Perreiro.«
Da plötzlich wird Mynheer van Koek
Aus seinen Gedanken gerissen;
Der Schiffschirurgius tritt herein,
Der Doktor van der Smissen.
Das ist eine klapperdürre Figur,
Die Nase voll roter Warzen -
»Nun, Wasserfeldscherer«, ruft van Koek,
»Wie geht's meinen lieben Schwarzen?«
Der Doktor dankt der Nachfrage und spricht:
»Ich bin zu melden gekommen,
Daß heute nacht die Sterblichkeit
Bedeutend zugenommen.
Im Durchschnitt starben täglich zwei,
Doch heute starben sieben,
Vier Männer, drei Frauen - Ich hab den Verlust
Sogleich in die Kladde geschrieben.
Ich inspizierte die Leichen genau;
Denn diese Schelme stellen
Sich manchmal tot, damit man sie
Hinabwirft in die Wellen.
Ich nahm den Toten die Eisen ab;
Und wie ich gewöhnlich tue,
Ich ließ die Leichen werfen ins Meer
Des Morgens in der Fruhe.
Es schossen alsbald hervor aus der Flut
Haifische, ganze Heere,
Sie lieben so sehr das Negerfleisch;
Das sind meine Pensionäre.
Sie folgten unseres Schiffes Spur,
Seit wir verlassen die Küste;
Die Bestien wittern den Leichengeruch
Mit schnupperndem Fraßgelüste.
Es ist possierlich anzusehn,
Wie sie nach den Toten schnappen!
Die faßt den Kopf, die faßt das Bein,
Die andern schlucken die Lappen.
Ist alles verschlungen, dann tummeln sie sich
Vergnügt um des Schiffes Planken
Und glotzen mich an, als wollten sie
Sich für das Frühstück bedanken.«
Doch seufzend fällt ihm in die Red'
Van Koek: »Wie kann ich lindern
Das Übel? wie kann ich die Progression
Der Sterblichkeit verhindern?«
Der Doktor erwidert: »Durch eigne Schuld
Sind viele Schwarze gestorben;
Ihr schlechter Odem hat die Luft
Im Schiffsraum so sehr verdorben.
Auch starben viele durch Melancholie,
Dieweil sie sich tödlich langweilen;
Durch etwas Luft, Musik und Tanz
Läßt sich die Krankheit heilen.«
Da ruft van Koek: »Ein guter Rat!
Mein teurer Wasserfeldscherer
Ist klug wie Aristoteles,
Des Alexanders Lehrer.
Der Präsident der Sozietät
Der Tulpenveredlung im Delfte
Ist sehr gescheit, doch hat er nicht
Von Eurem Verstande die Hälfte.
Musik! Musik! Die Schwarzen soll'n
Hier auf dem Verdecke tanzen.
Und wer sich beim Hopsen nicht amüsiert,
Den soll die Peitsche kuranzen.«
II
Hoch aus dem blauen Himmelszelt
Viel tausend Sterne schauen,
Sehnsüchtig glänzend, groß und klug,
Wie Augen von schönen Frauen.
Sie blicken hinunter in das Meer,
Das weithin überzogen
Mit phosphorstrahlendem Purpurduft;
Wollüstig girren die Wogen.
Kein Segel flattert am Sklavenschiff,
Es liegt wie abgetakelt;
Doch schimmern Laternen auf dem Verdeck,
Wo Tanzmusik spektakelt.
Die Fiedel streicht der Steuermann,
Der Koch, der spielt die Flöte,
Ein Schiffsjung' schlägt die Trommel dazu,
Der Doktor bläst die Trompete.
Wohl hundert Neger, Männer und Fraun,
Sie jauchzen und hopsen und kreisen
Wie toll herum; bei jedem Sprung
Taktmäßig klirren die Eisen.
Sie stampfen den Boden mit tobender Lust,
Und manche schwarze Schöne
Umschlinge wollüstig den nackten Genoß -
Dazwischen ächzende Töne.
Der Büttel ist Maître des plaisirs,
Und hat mit Peitschenhieben
Die lässigen Tänzer stimuliert,
Zum Frohsinn angetrieben.
Und Dideldumdei und Schnedderedeng!
Der Lärm lockt aus den Tiefen
Die Ungetüme der Wasserwelt,
Die dort blödsinnig schliefen.
Schlaftrunken kommen geschwommen heran
Haifische, viele hundert;
Sie glotzen nach dem Schiff hinauf,
Sie sind verdutzt, verwundert.
Sie merken, daß die Frühstückstund'
Noch nicht gekommen, und gähnen,
Aufsperrend den Rachen; die Kiefer sind
Bepflanzt mit Sägezähnen.
Und Dideldumdei und Schnedderedeng -
Es nehmen kein Ende die Tänze.
Die Haifische beißen vor Ungeduld
Sich selber in die Schwänze.
Ich glaube, sie lieben nicht die Musik,
Wie viele von ihrem Gelichter.
»Trau keiner Bestie, die nicht liebt
Musik!« sagt Albions großer Dichter.
Und Schnedderedeng und Dideldumdei -
Die Tänze nehmen kein Ende.
Am Fockmast steht Mynheer van Koek
Und faltet betend die Hände:
»Um Christi willen verschone, o Herr,
Das Leben der schwarzen Sünder!
Erzürnten sie dich, so weißt du ja,
Sie sind so dumm wie die Rinder.
Verschone ihr Leben um Christi will'n,
Der für uns alle gestorben!
Denn bleiben mir nicht dreihundert Stück,
So ist mein Geschäft verdorben.«
(1854)
Heines Siechtum, das ihn 1848-56 zum Pflegefall unter der Betreung seiner Ehefrau Mathilde werden ließ, ist zugleich die allerletzte Spielart der erotischen Liebe, wie er in dem Gedicht von der schwarzen Frau ebenso bildkräftig wie schonungslos, doch nicht ohne Selbstironie ausdrückt. Die fortschreitenden Lähmungen durch die syphilitische Rückenmarksschwindsucht haben den Dichter indes bis zuletzt nicht verstummen lassen, wie "Das Sklavenschiff" stammen die folgenden beiden Gedichte aus seinem vorletzten Lebensjahr. Wie er sie seiner 'Matratzengruft' abtrotzte, verrät der diese Auswahl beschließende Text.
Es hatte mein Haupt die schwarze Frau
Zärtlich ans Herz geschlossen;
Ach! meine Haare wurden grau,
Wo ihre Tränen geflossen.
Sie küßte mich lahm, sie küßte mich krank,
Sie küßte mir blind die Augen;
Das Mark aus meinem Rückgrat trank
Ihr Mund mit wildem Saugen.
Mein Leib ist jetzt ein Leichnam, worin
Der Geist ist eingekerkert -
Manchmal wird ihm unwirsch zu Sinn,
Er tobt und rast und berserkert.
Ohnmächtige Flüche! Dein schlimmster Fluch
Wird keine Fliege töten.
Ertrage die Schickung, und versuch,
Gelinde zu flennen, zu beten.
(1854)
Wie langsam kriechet sie dahin,
Die Zeit, die schauderhafte Schnecke!
Ich aber, ganz bewegungslos
Blieb ich hier auf demselben Flecke.
In meine dunkle Zelle dringt
Kein Sonnenstrahl, kein Hoffnungsschimmer,
Ich weiß, nur mit der Kirchhofsgruft
Vertausch ich dies fatale Zimmer.
Vielleicht bin ich gestorben längst;
Es sind vielleicht nur Spukgestalten
Die Phantasien, die des Nachts
Im Hirn den bunten Umzug halten.
Es mögen wohl Gespenster sein,
Altheidnisch göttlichen Gelichters;
Sie wählen gern zum Tummelplatz
Den Schädel eines toten Dichters. -
Die schaurig süßen Orgia,
Das nächtlich tolle Geistertreiben,
Sucht des Poeten Leichenhand
Manchmal am Morgen aufzuschreiben.
(1854)
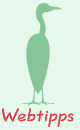 Heinrich Heine im Internet
Heinrich Heine im Internet
Meist durch Zitaten aus Schriften erläutert Wolfgang Frickes Heinrich-Heine-Denkmal die Lebens- und Zeitumstände des Dichters.
Eine Site zum Vergraben in Heinrich Heine, denn sein Gesamtwerk ist von A-Z registriert, vieles auch nachzulesen.
Das Heinrich Heine Portal hingegen, ein Projekt der Universität Trier, erschließt sämtliche Schriften wissenschaftlich und stellt sie der Weböffentlichkeit zur Verfügung.
Was beim Heine Institut in Düsseldorf zu finden ist und welche Veranstaltungen dort laufen, zeigt diese Site. Weiterhin gebt es Einblicke ins Archiv und das weltweit einzige Heine-Museum.
Verwandte Themen: Balladen · Joseph von Eichendorff · Gedichte der Romantik · Liebesgedichte · Muttertagsgedichte · Valentinstag-Gedichte
Alle Themen: Startseite